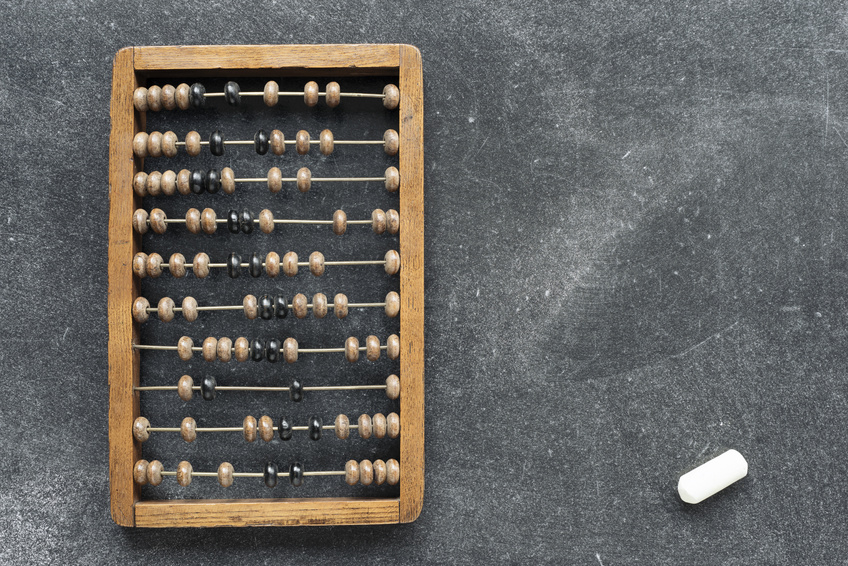»Läuft bei dir« war 2014 Jugendwort des Jahres. Bei der letzten Abstimmung 2016 belegte »fly sein« den ersten Platz.
Die Jungen gegen die Alten?
Aber existiert dadurch so etwas wie eine Rivalität zwischen Jung und Alt? Wirft man einen Blick in die Sprachwissenschaft, könnte man geneigt sein, dem zuzustimmen. Denn nicht nur die Interessen und Meinungen unterscheiden sich zwischen der Jugend und den Generationen höheren Alters, sondern ebenso die Sprache. Die sogenannte Jugendsprache wird allseits fleißig zitiert, und es folgt die Unterstellung, sie sei das beste Beispiel für den Verfall der deutschen Sprache. Lange Zeit wurde sie als Lebensalter-Sprache bezeichnet und galt in ihrer Form auf den Zeitraum eines Menschenlebens begrenzt. Heute fasst man Jugendsprachen hingegen nicht mehr als halbwegs eigenständige Sprachsysteme, sondern als komplexe Varianten der Standardsprache auf, auch Varietäten genannt. Da die Jugend an sich aber keineswegs so gleichförmig ist, wie der schlichte Begriff Jugendsprache vermuten lässt, existieren vielmehr mehrere Jugendsprachenvarietäten nebeneinander, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Je nach gesellschaftlichem Umfeld zeichnen sich also jugendsprachliche Varietäten ab: In der Schule wird unter Jugendlichen nicht so gesprochen wie auf dem Sportplatz, aber auch nicht so wie in der Universität oder in unterschiedlichen Musikszenen. Gemeinsam ist all diesen sprachlichen Variationen jedoch ihr Kontrast zur Standardsprache, der in grammatischer und lautlicher Hinsicht hervortritt, aber auch im Hinblick auf Wortbildungen und die Verwendung von einzelnen Wörtern deutlich wird.
Es geht um Gefühle, Selbstfindung und Meuterei
Warum sprechen Jugendliche aber anders als ihre Vorgängergenerationen? Der Linguist Hermann Ehmann (1992: Affengeil. Das Lexikon der Jugendsprache. 1996: Oberaffengeil. Neues Lexikon der Jugendsprache. 2001: Voll konkret. Das neueste Lexikon der Jugendsprache. 2005: Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache) hat auf diese Frage gleich mehrere Antworten: Die Verwendung von Jugendsprache dient nach Ehmann der Abgrenzung von anderen (Generationen) und übt Kritik an bestehenden sprachlichen, aber auch gesellschaftlichen Normen. Mit dieser Distanzierung zur Erwachsenenwelt entsteht für Jugendliche gleichzeitig ein eigener Raum für Selbstdefinition in Bezug auf die eigene Identität. Sprache wird zum Emotionsventil und dient der Abreaktion während des konfliktgeladenen Stadiums der Pubertät. Dadurch, dass Jugendsprache sich durch mehr Dynamik auszeichnet, stärker subjektiv ist und auch weniger regelhaft und verkrampft, dafür aber kreativer als die Standardversion, ist sie bei geringerem Aufwand laut Ehmann mindestens genauso effizient. So entstehen unter Jugendlichen zum Beispiel Begriffe wie »funzen« (funktionieren), »latte« (egal), »pumpen« (Sporttreiben im Fitnessstudio) oder »kicken« (Spaß machen). Oft werden Wörter vereinfacht oder neu erfunden, Bedeutungen erweitert, verschoben oder verändert und manchmal komplette Sätze neu geschöpft: »Was ist Phase?« entspricht zum Beispiel der Frage »Was ist los?«.
Jugendsprachen als Spiegelbilder der Welt
Obwohl all dies für einen hohen Grad an Kreativität spricht, wird Jugendlichen in ihrer Sprachverwendung häufig Faulheit unterstellt. Immer wieder werden sie auch für die fremdsprachlichen Anleihen kritisiert, die sie in ihrem Alltag verwenden. Vor allem bei Anglizismen geraten selbst ernannte Care-Taker in den Rage-Modus, weil sie finden, dass Wörter dieser Art fake sind und die deutsche Sprache destroyen. Angeblich sei Jugendkultur in der Meinung der Sprachpfleger also maßgeblich für den Niedergang der deutschen Sprache mitverantwortlich. Dass all die Kritikübenden außer Acht lassen, dass sie wohl selbst als Jugendliche ihre Sprache mit Wörtern wie »knorke«, »Jeans« oder »Proll« mitgeprägt haben, scheinen sie dabei vergessen zu haben. Aber noch mehr: Indem Jugendsprache als Gefahr betrachtet wird, vertauschen sie die Ursache mit der Wirkung. Sie lassen die Tatsache unbeachtet, dass Jugendliche mit ihrer Sprache ihre Umgebung wiedergeben, also im Grunde nur die gegebenen Zustände reproduzieren, indem sie mit ihrer Sprache ein Spiegelbild der Gesellschaft schaffen. So schleusen junge Menschen die globalisierte Welt, die sie umgibt, mit transnationalen Einflüssen aus Sprache, Kultur und neuen Medien in ihre Sprache ein. Und diese Welt wurde von den älteren Generationen gestaltet.
Hinhören statt vorschreiben
In der experimentellen Sprachvariante, die die Jugendlichen verwenden, ist also mehr zu entdecken als der bloße Angriff auf Autorität, Norm und Konvention, und zwar sowohl in sprachlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Wenn man also wie die Vereinten Nationen das Anliegen hat, Kinder und Jugendliche zu fordern und zu fördern, sollte man nicht damit beginnen, den Maßstab der Standardsprache anzulegen und sie in bestehende Muster und Konventionen zu pressen. Vielleicht lohnt es sich vielmehr, bei all dem jugendlichen Kauderwelsch mal genauer hinzuhören. Vielleicht ja auch gerade heute, am 17. Geburtstag des Welttags der Jugend.