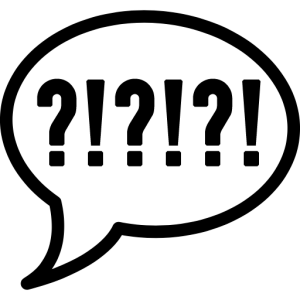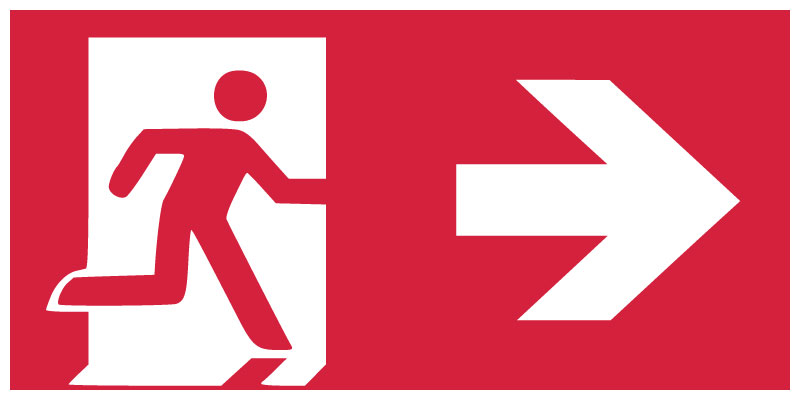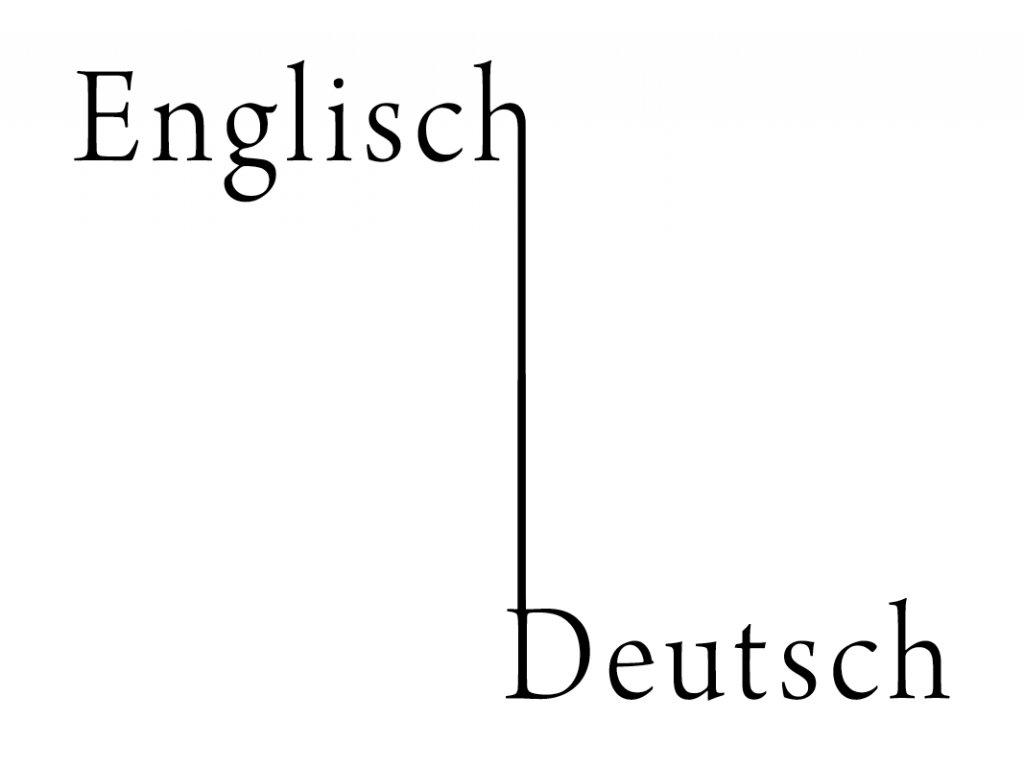Welches Anhängsel darf‘s denn sein?
kindlich versus kindisch
Weitere Nachsilben, die sich neben »lich« und »isch« mit anderen Wortarten zu Adjektiven verbinden, sind zum Beispiel »bar«, »en«, »ern«, »los«, »sam« oder »haft«. Trotzdem führen sie am Ende selten zur gleichen Bedeutung: Ein Baum ist nicht gewaltsam, nur weil er gewaltig ist; ein Apfel ist fruchtig (fruchtlich ist er nicht) und nur seine Kerne sind fruchtbar; die Natur ist achtbar, aber kann sie auch achtsam sein?
Wenden wir uns zunächst mal den drei von der Form her ähnlichsten Nachsilben zu: »ig«, »lich« und »isch«.
Durch Adjektive mit »ig« wird ausgesagt, dass das, was vom Stamm bezeichnet wird, in irgendeiner Form vorhanden ist. Ein Beispiel hierfür wäre also: »Draußen ist es ruhig. – Draußen ist Ruhe vorhanden.« Währenddessen schreiben die Nachsilben »lich« und »isch« dem neu entstehenden Adjektiv im Grunde die gleiche Bedeutung zu. Sie sagen aus, dass das folgende Wort in irgendeiner Weise von der Art des Wortstammes ist oder mit ihm zu tun hat: »Die Demonstration verlief friedlich. – Die Demonstration verlief von der Art des Friedens.« Auffällig ist dabei, dass sich trotzdem nicht jedes Nomen beliebig mit »lich« oder »isch« verbinden kann und dass es bei den Wörtern, bei denen die Adjektivbildung mit beiden Suffixen funktioniert, verschiedene Konnotationen gibt. Man vergleiche dazu einmal »bäuerlich« mit »bäurisch«, »kindlich« mit »kindisch« oder »weiblich« mit »weibisch«. Die »isch«-Version des jeweiligen Adjektivs wird hier abwertend verwendet und hat eine negative Konnotation, bezeichnet aber im Grunde das Gleiche.
Und wie verhält es sich mit anderen Nachsilben?
Wie facettenreich die Suffixe des Deutschen sind, zeigt folgende (wenn auch unvollständige) Liste:
• Bei Adjektiven, die auf »bar« enden, wird auf eine Handlung Bezug genommen, genauer gesagt auf das, was mit jemandem oder etwas gemacht werden kann: »Dieser Apfel ist essbar. – Man kann ihn essen.«
• Bei »en« und »ern« wird auf den Stoff verwiesen, aus dem etwas gemacht ist: »Die Krone ist hölzern. – Sie ist aus Holz gemacht.«
• »haft« drückt häufig einen Vergleich zwischen der beschriebenen Person oder Sache und dem zugrunde liegenden Nomen aus: »Der Junge benimmt sich babyhaft. – Er benimmt sich wie ein Baby.«
• Kommen wir zu unserem Beispiel mit dem gewaltsamen Baum zurück, stellt sich heraus: »sam« beschreibt, dass der beschriebene Baum von dem Ursprungswort, hier also Gewalt, erfüllt ist. Und Gewalterfülltsein ist für einen Baum eine eher untypische Eigenschaft. (Im Gegensatz dazu kann er aber gewaltig sein, weil in gewisser Weise Gewalt vorhanden ist bzw. er einen Eindruck von Gewalt machen kann.)
• Das Suffix »los« ist ziemlich selbsterklärend: »Der Text ist makellos. – Er hat keine Makel.«
Wem das bei all diesem Bedeutungswirrwarr zu kompliziert ist, der/die kann sich auch auf sogenannte primäre Adjektive beschränken. Diese existieren einfach so und haben selbstständige Bedeutungen, die nicht durch Nachsilben von anderen Wortarten abgeleitet wurden. Dazu gehören zum Beispiel »gut«, »schlecht«, »alt«, »jung«, »wahr«, »falsch«, »schlau«, »dumm«, »schief« und »krumm«. Anstatt eines Sechstels des Gesamtwortschatzes des Deutschen, hat man hier dann aber nur etwa 250 Wörter zur Auswahl. Und das ist auf Dauer vielleicht doch ein bisschen langweilig.